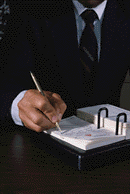Wie kann das verhindert werden?

Die Regelung des § 268 der Abgabenordnung (AO) und die damit verbundene Aufteilung einer Gesamtschuld haben erhebliche Auswirkungen auf Ehegatten, die zur Einkommensteuer zusammenveranlagt werden. Gerne erläutere ich die Zusammenhänge und Konsequenzen.
Grundprinzip: Die Gesamtschuldnerschaft bei Zusammenveranlagung
Wenn Ehegatten die Zusammenveranlagung wählen, werden sie steuerrechtlich zu Gesamtschuldnern (§ 44 AO). Das bedeutet, dass jeder Ehegatte für die gesamte Steuerschuld haftet, nicht nur für den Teil, der auf sein eigenes Einkommen entfällt. Das Finanzamt kann sich also aussuchen, von wem es die gesamte Steuernachzahlung fordert. Dies birgt insbesondere bei Trennung, Scheidung oder Insolvenz eines Partners erhebliche finanzielle Risiken für den anderen.
Die Schutzfunktion des § 268 AO
Genau hier setzt § 268 AO an. Er dient als Schutzmechanismus, um diese unbeschränkte Haftung zu durchbrechen.
(§ 268 AO - Aufteilung einer Gesamtschuld)Die wesentliche Auswirkung ist, dass jeder Ehegatte einen Antrag auf Aufteilung der Gesamtschuld stellen kann. Dieser Antrag bewirkt, dass die gemeinsame Steuerschuld nach einem bestimmten Maßstab auf die beiden Ehegatten verteilt wird.
Wie erfolgt die Aufteilung?
Die Berechnung der Aufteilung ist in § 270 AO geregelt. Die Gesamtschuld wird im Verhältnis der Beträge aufgeteilt, die sich bei einer fiktiven getrennten Veranlagung für jeden Ehegatten ergeben würden.
Vereinfachtes Beispiel:
- Ehegatte A hätte bei getrennter Veranlagung 30.000 € Steuern zahlen müssen.
- Ehegatte B hätte bei getrennter Veranlagung 10.000 € Steuern zahlen müssen.
- Die gemeinsame Steuerschuld bei Zusammenveranlagung beträgt 35.000 €.
Die Aufteilung erfolgt im Verhältnis 3:1.
- Anteil A: (30.000 / 40.000) * 35.000 € = 26.250 €
- Anteil B: (10.000 / 40.000) * 35.000 € = 8.750 €
Auswirkungen der Aufteilung
Sobald der Aufteilungsbescheid rechtskräftig ist, treten entscheidende Konsequenzen ein:
- Haftungsbeschränkung: Die wichtigste Folge ist die Begrenzung der Vollstreckung. Gemäß § 278 AO darf das Finanzamt bei jedem Ehegatten nur noch den auf ihn entfallenden Teilbetrag vollstrecken. Die gesamtschuldnerische Haftung für die gesamte Schuld erlischt. Sie haften also nicht mehr für die Steuerschulden Ihres Partners.
- Schutz des eigenen Vermögens: Ihr persönliches Vermögen ist vor dem Zugriff des Finanzamts wegen der Steuerschulden des anderen Ehegatten geschützt. Dies ist besonders relevant, wenn ein Partner vermögenslos ist oder sich in Insolvenz befindet.
- Getrennte Verfahren: Nach der Aufteilung führt das Finanzamt die Vollstreckungsverfahren für die jeweiligen Restschulden getrennt gegen jeden Ehegatten.
Praktische Anleitung und Voraussetzungen
- Antragstellung: Die Aufteilung erfolgt nicht automatisch, sondern nur auf schriftlichen oder elektronischen Antrag eines der Ehegatten beim zuständigen Finanzamt. Der Antrag ist an keine besondere Form gebunden, sollte aber klar als "Antrag auf Aufteilung der Gesamtschuld gemäß § 268 AO" für die betreffenden Steuerjahre und Steuernummern bezeichnet werden.
- Zeitpunkt: Der Antrag kann gestellt werden, solange die Steuerschuld noch nicht vollständig bezahlt ist. Eine frühzeitige Antragstellung, insbesondere bei sich abzeichnenden finanziellen Schwierigkeiten eines Partners oder einer Trennung, ist ratsam.
- Kosten: Für den Antrag selbst fallen keine Gebühren an.
Zusammenfassende Bewertung der Auswirkungen
Aspekt
Ohne Aufteilung (§ 44 AO) Mit Aufteilung (§ 268 AO)
Haftung Jeder Ehegatte haftet für 100% der Steuerschuld. Jeder Ehegatte haftet nur für seinen errechneten Anteil.
Vollstreckung Das Finanzamt kann das gesamte Vermögen eines Die Pfändung ist auf die Höhe des jeweiligen Anteils begrenzt.
Ehegatten für die Gesamtschuld pfänden.
Risiko Hohes finanzielles Risiko, wenn der Partner zahlungsunfähig wird. Deutliche Risikominimierung und Schutz des eigenen Vermögens.
Verfahren Ein gemeinsames Vollstreckungsverfahren. Zwei getrennte Vollstreckungsverfahren nach der Aufteilung.
Zusammenfassend ist § 268 AO ein essenzielles Instrument zum Schutz von Ehegatten vor der unbegrenzten Haftung aus der Zusammenveranlagung. Er ermöglicht eine faire Verteilung der Steuerlast entsprechend der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit jedes Einzelnen und sichert das persönliche Vermögen.