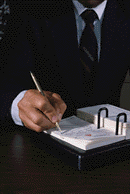Insolvenzberatung aus Karlsfeld – Was passiert mit der Selbstständigkeit bei einer Insolvenz?
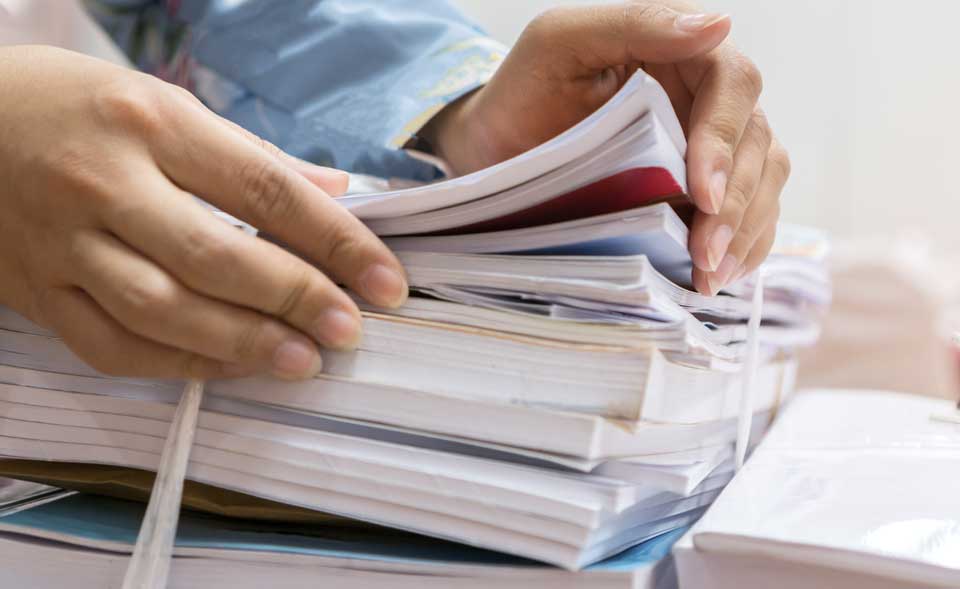
Gerade nach dem zweiten Lockdown sind viele Selbstständige und Gewerbetreibende von hohen Schulden belastet und ein Insolvenzverfahren droht. Was viele Betroffene nicht wissen, ist, dass ein Insolvenzverfahren auch als Chance für einen wirtschaftlichen Neuanfang angesehen werden kann.
Welche Vorteile bietet das Insolvenzverfahren für Selbstständige?
Im Insolvenzverfahren besteht ein Rechtsanspruch auf eine selbstständige oder gewerbliche Tätigkeit. Sie bleiben weiterhin Inhaber mit alleiniger unternehmerischer Verantwortung. In der Regel wird der Insolvenzverwalter die Firma nach dem vorläufigen Insolvenzverfahren freigeben. Während dieser Zeit können keine Vollstreckungen wegen der Altschulden erfolgen. Sie machen wirtschaftlich sozusagen einen Neustart.
Weitere Vorteile sind, dass die Wohnung des Schuldners geschützt ist, dass der PKW, der zur beruflichen Tätigkeit benötigt wird, nicht gepfändet werden kann und Sie rundum wieder krankenversichert sind und die Krankenkasse keine Leistungen einbehalten kann, aufgrund der Rückstände.
Weshalb wird der Insolvenzverwalter den meisten Fällen die selbstständige Tätigkeit freigeben?
Wenn die Firma nicht freigegeben wird und der Insolvenzverwalter die Selbstständigkeit fortführt, haftet er für alle neu entstehenden Verbindlichkeiten persönlich. Daran wird er sicherlich kein Interesse haben. Da der Insolvenzverwalter den Schuldner nicht dauerhaft überwachen kann, wird er dieses hohe Risiko nicht eingehen. Dies bedeutet für den Schuldner, dass die Tätigkeit außerhalb des Insolvenzverfahrens fortgeführt wird. Wegen der Altschulden sind auch keine Zwangsvollstreckungsmaßnahmen möglich. In diesem Fall stehen dem Schuldner grundsätzlich die unternehmerischen Gewinne zu.
Der Gesetzgeber hat entschieden, dass alle erzielten Gewinne dem Insolvenzschuldner bleiben und nicht an den Insolvenzverwalter abzugeben sind. Daher muss der Schuldner auch das finanzielle Risiko der Fortführung tragen.
Muss ich meine gesamten Gewinne abgeben?
Während des Insolvenzverfahrens muss der Schuldner den fiktiven pfändbaren Teil seines Einkommens an den Insolvenzverwalter abführen. Da ein Selbstständiger kein Einkommen hat wie ein Angestellter, sondern nur Gewinne, wird geprüft, welches Einkommen der Schuldner mit seiner Tätigkeit erzielen würde, wenn er diese Tätigkeit als Angestellter erbringen würde. Und dieses sogenannte Arbeitseinkommen ist die Grundlage zur Berechnung des pfändbaren Anteils. Dazu wird die Pfändungstabelle herangezogen.
Mit dem Insolvenzverwalter wird dieses fiktive Einkommen abgestimmt. Der abzuführende Betrag wird vereinbart und kann monatlich oder auch quartalsweise an den Insolvenzverwalter abgeführt werden. Seit Oktober 2020 kann man das fiktive Einkommen auch durch das Insolvenzgericht bestimmen lassen.
In einigen Fällen wurden auch Gewerbeuntersagungsverfahren von den Landratsämtern eingeleitet. Trotzdem ist auch im Insolvenzverfahren eine Selbstständigkeit weiterhin möglich.
Wagen Sie den Neuanfang!
Die Bedenken der Selbstständigen, dass bei einem Insolvenzverfahren der ganze Gewinn an den Insolvenzverwalter gezahlt werden muss, sind unbegründet. Aus diesem Grund kann man jedem nur empfehlen, der überschuldet ist, einen Neustart durch Insolvenz zu wagen.
Gerade im Bereich Dachau, München und Niederbayern erhalten Sie fachgerechte Hilfe durch den Verein für Existenzsicherung e. V. Nutzen Sie die Chance für einen Neuanfang!