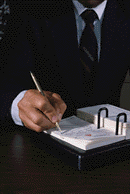Der Unterschied zwischen einer Regelinsolvenz und einer Verbraucherinsolvenz – erklärt von Ihrer Insolvenzberatung aus Karlsfeld

Wenn es sich beim Schuldner um eine juristische Person, wie eine GmbH, OHG, AG usw. handelt, muss immer ein Regelinsolvenzverfahren durchgeführt werden.
Wenn der selbstständige Schuldner eine Person ist, muss geprüft werden, ob er noch eine selbständige wirtschaftliche Tätigkeit ausübt, ist das Regelinsolvenzverfahren durchzuführen. Falls er trotz Insolvenz weiterhin selbstständig bleiben möchte, ist dies selbstverständlich möglich.
Für den Fall, dass er die Firma aufgeben möchte, muss geprüft werden, ob die Vermögensverhältnisse überschaubar sind. Das bedeutet maximal 19 Gläubiger und dass keine Forderungen aus Arbeitsverhältnissen bestehen. Das sind Verbindlichkeiten aus Sozialversicherungsabgaben und Lohnsteuerverbindlichkeiten.
In diesem Fall kann das Verbraucherinsolvenzverfahren angewandt werden. Sind mehr als 19 Gläubiger oder Verbindlichkeiten aus Sozialführungsaufgaben und Steuerverbindlichkeiten vorhanden, muss das Regelinsolvenzverfahren durchgeführt werden.
Was ist bei einem Regelinsolvenzverfahren zu beachten?
Der Antrag auf ein Regelinsolvenzverfahren kann durch den Schuldner oder auch durch einen Gläubiger gestellt werden. In den meisten Fällen werden die Fremdanträge für ein Regelinsolvenzverfahren durch die Krankenkassen gestellt.
Falls der Fremdantrag von einer Krankenkasse gestellt wird, ist zu beachten, dass innerhalb von 14 Tagen ein Eigenantrag des Schuldners gestellt werden muss. Hat er dies unterlassen, erhält er nach Ablauf des Insolvenzverfahrens keine Restschuldbefreiung. Das bedeutet, dass nach Beendigung des Insolvenzverfahrens alle Schulden noch vorhanden sind. Aus diesem Grund ist es wichtig alle Schreiben vom Gericht zu lesen und sich während des Insolvenzverfahrens von einer fachkundigen Stelle betreuen zu lassen. Wer sich selbst um das Verfahren kümmert, kann sehr viele teure Fehler machen. Der VfE e. V. arbeitet deshalb mit Fachanwälten für Insolvenzrecht zusammen, die in diesen Fällen die Beratung und Bearbeitung übernehmen. Gerade bei Regelinsolvenzverfahren gibt es viele Fallstricke zu beachten und die Probleme kommen meistens erst , wenn der Insolvenzverwalter die Unterlagen prüft.
Unterschied zum Verbraucherverfahren
Ein weiterer Unterschied ist, dass bei einem Verbraucherinsolvenzverfahren das Gericht das Verfahren sofort eröffnet. Bei einem Regelinsolvenzverfahren wird ein vorläufiges Insolvenzverfahren vorgeschaltet, dass durchschnittlich drei Monate andauert. Erst danach eröffnet das Gericht das Insolvenzverfahren.
Während dem vorläufigen Insolvenzverfahren prüft der Insolvenzverwalter, ob das Unternehmen weitergeführt werden kann oder nicht. Der Insolvenzverwalter entscheidet auch, ob er das Unternehmen selbst weiterführen will oder ob er das Unternehmen freigibt.
Wenn der Insolvenzverwalter das Unternehmer selbst weiterführen will, ist er auch vollumfänglich für das Unternehmen verantwortlich. Er hat sich um die Steuern zu kümmern, um das Personal kümmern und hat alle Aufgaben des ehemaligen Inhabers zu erfüllen. Er hat alle Zahlungen, wie Sozialversicherungsbeiträge, Gehälter, Steuern, Sicherungsbeiträge sowie alle Betriebsausgaben zu leisten und ist dann unternehmerisch tätig.
Freigabe durch den Insolvenzverwalter
Er kann aber auch das Unternehmen freigeben. In diesem Fall ist der Unternehmer ab diesem Zeitpunkt wieder selbst für sein Unternehmen verantwortlich und muss sich um alle Zahlungen kümmern. Der Unternehmer wird in dieser Zeit einen vereinbarten Betrag an den Insolvenzverwalter bezahlen um die Gläubiger zu bedienen.
In einem uns vorliegenden Fall hat der Insolvenzkunde eine Bäckereifiliale übernommen. Bei dem Erstgespräch mit dem Insolvenzverwalter hat dieser angedeutet, die Firma nicht freizugeben, sondern selbst weiter zu führen. Scheinbar ist dem Insolvenzverwalter nicht klar, welche Arbeit auf ihn zukommt. Er muss als erstes die Kaution in Höhe von 20.000 € bezahlen. Des Weiteren hat er sich darum zu kümmern, welche Mitarbeiter und wann zur Schicht eingeteilt werden. Er muss sich um die Kasse kümmern und das Bargeld einzahlen, sowie um die täglichen Bestellungen der Filiale. Falls er doch entscheidet die Filiale als Insolvenzverwalter weiterzuführen, wünsche ich ihm viel Spaß damit. Man kann hier sagen: außer Spesen nichts gewesen. Mittlerweile hat der Insolvenzverwalter den Bäckereibetrieb freigegeben.
Wenden Sie sich an eine erfahrene Schuldnerberatung
Gerade bei einem Insolvenzverfahren für Firmen ist es sehr wichtig, mit erfahrenen Schuldenberatern zusammenzuarbeiten. Die karitativen Schuldnerberatungsstellen, die eine Zulassung nach § 305 InsO besitzen, dürfen nur Verbraucherinsolvenzfälle bearbeiten und keine Regelinsolvenzen. Firmen, die in einer finanziellen Notlage sind, können sich auch an Rechtsanwälte oder den Verein für Existenzsicherung e. V., gegründet 1986, wenden, der seit 1999 mit der Schuldenberatung tätig ist. Wir helfen bedrohten Firmen auch in der Corona-Krise – wie schon seit 35 Jahren. Unser Schuldenberater Johann Tillich bietet Ihnen zusammen mit Fachanwälten für Insolvenzrecht Hilfe bei Schulden an. Das Ziel ist: Raus aus den Schulden und eine Firmeninsolvenz oder Verbraucherinsolvenz zu vermeiden.
Wichtig für die Firmen ist auch, welche Kosten entstehen. Bei Rechtsanwälten fallen Kosten von mehreren tausenden Euro an. In einem vorliegenden Fall betrugen die Kosten ca. 15.000 Euro. Unsere günstigen Kosten erfahren Sie bei der kostenlosen Erstberatung. Weitere Informationen unter www.vfe-schuldenberatung.de. In Problemfällen, die von unseren Rechtsanwälten bearbeitet werden, können auch höhere Kosten anfallen, die aber vorher vereinbart werden.
Johann Tillich prophezeit Pleitewelle und überforderte Gerichte
„Auf uns rollt eine massive Pleitewelle von kleinen und mittleren Unternehmen zu“, prophezeit Johann Tillich, Gründer und Präsident des Vereins für Existenzsicherung (VfE) e.V., eine Organisation, die sich seit mehr als drei Jahrzehnten auf die Schuldenberatung in Karlsfeld und München bei Regelinsolvenz und Verbraucherinsolvenz spezialisiert hat. Es ist wichtig, die Voraussetzungen, um eine Privatinsolvenz anmelden zu können, zu kennen. Er erklärt: „Die Insolvenzantragspflicht für Firmen war im vergangenen Jahr zwar wegen der Pandemie ausgesetzt worden, doch wenn sie irgendwann wieder einsetzt, müssen viele Unternehmer den Gang zum Insolvenzrichter gehen.“ Die Firmeninhaber und ihre Geschäftsführer treffen dann auf Gerichte, die im Akkord arbeiten müssen, so Tillich. Sie treffen manchmal auf unerfahrene Insolvenzverwalter – denn einige Kanzleien stocken nun kurzfristig ihr Personal auf, um dem Ansturm gewappnet zu sein.
Erfahrener Schuldnerberater bekannt aus dem Fernsehen
Johann Tillich hingegen ist ein erfahrener und gefragter Fachmann. Der geprüfte Anlagen- und Vermögensberater wird seit Jahren im TV als Experte befragt („Akte“ SAT 1, „Mona Lisa“ ZDF, „Spiegel-TV“). Derzeit ist er in der RTL-Dokumentation „Leben am Limit – Einsatz für den Schuldnerberater“ zu sehen. Am 17.01.2021 lief ein Beitrag im ZDF „Vorsicht Falle“. Hier wurde über einen aufgedeckten Betrug mit „Bitcoin“ berichtet.
Das Karlsfelder VfE-Team konzentriert sich derzeit auf gefährdete Firmen. „Dadurch retten wir die Jobs der Angestellten, die durch Arbeitslosigkeit in die Zahlungsunfähigkeit rutschen könnten“, erläutert Johann Tillich. „Eine Firmeninsolvenz heißt nicht, dass man den Geschäftsbetrieb einstellen muss“, fährt der Sanierungsprofi fort, „nach dem Antrag sind die Schulden weg, man erhält eine neue Steuernummer und kann weiter arbeiten.“ Entscheidend seien die Verhandlungen mit den Insolvenzverwaltern, so der VfE-Chef weiter. Die Anwälte müssen überzeugt werden, dass eine Fortführung des Betriebs möglich ist. Zudem müssen bei geschuldeten Sozialbeiträgen Ratenzahlungen mit den Krankenkassen vereinbart werden. „Ein Fachmann, der schon hunderte solcher Gespräche geführt, tut sich dabei leichter, als ein Unternehmer, der das erste Mal in seinem Leben mit einer derartigen Situation konfrontiert ist“, weiß Johann Tillich. Derzeit berät er mehrere Gastronomiebetriebe, einen Getränkehändler, weitere Speditionen oder auch einen Kosmetiksalon. In einem Fall konnte eine außergerichtliche Lösung mit allen Gläubigern erreicht werden. Auf den Schuldenstand von 700.000,00 € konnte eine Vereinbarung bei ca. 20 % getroffen werden. Dies bedeutet eine Zahlung von 140.000,00 €.
Neue Büroräume für den Verein für Existenzsicherung
Anfang Januar haben Johann Tillich und sein Team ein neues Büro im Karlsfelder Gründerzentrum in der Nußbaumstraße 8 bezogen. Manche junge Firma wird vermutlich froh sein, einen erfahrenen Finanzfachmann als Nachbarn zu haben. Im vergangenen Frühjahr wurde der geprüfte Anlagen- und Vermögensberater übrigens von der IHK München und Oberbayern für seine mehr als zwanzigjährige ehrenamtliche Tätigkeit als Prüfer für die Berufe Fachwirt/Fachberater für Finanzdienstleistungen ausgezeichnet.
Nutzen Sie die kostenlose Erstberatung
Johann Tillich rät Firmeninhabern und Geschäftsführern, deren Unternehmen gefährdet sind: „Zögern Sie nicht! Werden Sie rechtzeitig tätig und wenden sich an einen Fachmann.“ Terminvereinbarungen sind unter 08131/93298 oder unter
info@vfe.de. Wir beraten Firmen Landkreis Dachau, Landkreis München, Niederbayern und im gesamten Bundesgebiet. Lassen Sie sich durch uns beraten, denn die Erstberatung ist kostenlos!