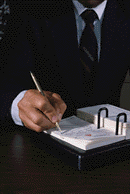Die skrupellosen Methoden unseriöser Immobilienmakler

Vorsicht beim Wohnungskauf: Unseriöse Makler versprechen ahnungslosen Opfern gerne Steuerersparnisse und unrealistische Gewinne.
Doch minderwertige Immobilien halten nicht, was sie versprechen.
Die Masche unseriöser Immobilienmakler scheint immer die gleiche zu sein: Beim Kauf einer Wohnung versprechen sie ihren ahnungslosen Opfern enorme Gewinne, enorme Steuerersparnisse, eine sichere Altersvorsorge und garantierte Gewinne beim Wiederverkauf. Der Kauf einer Wohnung ohne Eigenkapital ist angeblich kein Problem. Doch am Ende entpuppen sich solche Geschäfte oft als Reinfall - wie bei Michael Maier (Name durch die Redaktion geändert) und seiner Frau. Sie kauften vor 4 Jahren eine Wohnung in Waldheim. Das Versprechen der Vermittler: Eine monatliche Zuzahlung von maximal 90 Euro reicht, um das Darlehen für die Wohnung in den ersten zehn Jahren zu tilgen. Danach, wenn der Steuervorteil wegfalle, könne die Immobilie mit erheblichem Gewinn weiterverkauft werden.
Schon bald nach dem Kauf stellte sich für die Maiers heraus: Das war eine Lüge. Denn laut einem unabhängigen Gutachten war die Wohnung nur die Hälfte des Kaufpreises wert. Michael Maier hatte zu viel gezahlt. Und statt dem versprochenen Gewinn, beläuft sich die monatliche Belastung für die Wohnung nun auf durchschnittlich 290 Euro. Extras kann sich die Familie längst nicht mehr leisten. Selbst eine Ausbildungsbeihilfe für den Sohn ist nicht drin. Die Maiers wollten fürs Alter vorsorgen, jetzt stehen sie vor dem finanziellen Ruin.
Betrügerisches Geschäftsmodell
Bereits in den neunziger Jahren wurden mit diesem betrügerischen Geschäftsmodell rund 1 Million Menschen in Deutschland betrogen. Selbst der Verein für Existenzsicherung e.V. hat in ca. 20 Jahren ca. 5000 Fälle durch Verhandlungen mit den finanzierenden Banken außergerichtlich lösen können. Danach war lange Zeit Ruhe. Seit 1998 wurden wieder Steuersparmodelle, meistens in den ehemaligen Ostgebieten, wieder an ahnungslose Verbraucher verkauft. Da zu diesem Zeitpunkt die Zinsen sehr niedrig waren, war auch die Belastung sehr niedrig. Mittlerweile sind die Zinsen massiv gestiegen und die Belastung hat sich nach der auslaufende Zinsbindung teilweise verdreifacht. Selbst die finanziellen Banken sind nicht mehr bereit Damen zu verlängern, da Immobilien nicht werthaltig sind.
So wie Michael Maier geht es mehreren 100.000 Menschen in Deutschland, schätzt Johann Tillich, der Finanzexperte des Verein Existenzsicherung e. V. Sie alle haben überteuerte Immobilien gekauft, meist in Ostdeutschland. Der tatsächliche Marktwert ihrer Wohnung liegt in vielen Fällen 50 Prozent unter dem, was die Käufer bezahlt haben - und wofür sie sich verschuldet haben. Dahinter steckt laut Johann Tillich ein betrügerisches Geschäftsmodell. Ein Bauträger oder Investor kauft eine Immobilie, die er sanieren will. Nach der Sanierung hat sie einen Marktwert von zum Beispiel 100.000 Euro. Damit er die Immobilie schnell verkaufen kann, beauftragt er einen Verkäufer. Die Vertriebsprofis verschicken Hochglanzprospekte mit Steuersparversprechen, telefonieren mit potenziellen Käufern - und verkaufen die Immobilie. Doch die Käufer zahlen für die Immobilie das Doppelte, zum Beispiel 200.000 Euro. Die Bank, die dem Käufer den Kredit gegeben hat, überweist das Geld an den Bauträger. Die Provision beträgt zwischen 20 und 40 Prozent dieser Summe.
Fette Gewinne, nur nicht für die Käufer.
Bereits in den neunziger Jahren stellt sich die Frage, wie verkaufen Immobilienvermittler diese Wohnungen? Denn meist kommt der Kontakt zu potenziellen Käufern gar nicht über ein Immobilienangebot zustande. Am Anfang, am Telefon und bei den ersten Gesprächen, ging es gar nicht um eine Wohnung, sondern nur um 'Steuern sparen', erinnert sich Michael Maier. "Das wurde uns anhand eines Wohnungskaufs erklärt. Konkret wurde es erst, als wir im Vertriebsbüro in Berlin saßen. Dort sollten wir uns innerhalb von 24Stunden für die Wohnung entscheiden, weil es noch andere Interessenten gab. Die Kreditzusagen hatten die Damen und Herren angeblich schon von der Bank. Und der Notar in Berlin war auch schon gebucht", berichtet Maier von der Verkaufsmasche. Ein Steuersparangebot wie das von Michael Maier ist für die Verkäufer oft der Zugang zu Unterlagen und Vermögensverhältnissen otenzieller Käufer.
Johann Tillich . Verbraucherschützer vom Verein Existenzsicherung e. V. warnt deshalb vor derart vermittelten Immobilienkäufen. Zwar spricht grundsätzlich nichts gegen den Kauf einer Wohnung als Geldanlage oder Altersvorsorge zu kaufen. Aber: Nur zu einem angemessenen Preis. Dann bringen diese eine vernünftige Rendite. Man sollte keine Wohnung kaufen, die man nicht selbst besichtigt und geprüft hat. Interessenten sollten vorher eine Wertermittlung durch einen unabhängigen Sachverständigen einholen. Diese Investition kann sich lohnen.
Was Sie beim Immobilienkauf beachten sollten, um sich vor Betrug und dem Kauf einer sogenannten
"Schrottimmobilie" zu schützen, hat Johann Tillich, Verein für Existenzsicherung e. V. im Folgenden zusammengestellt:
Angebot und Kostenvoranschlag hinterfragen.
Keine Anrufe, sogenannte "cold calls", entgegennehmen. Wenn Unbekannte anrufen und Steuerersparnis anbieten, stecken meist Verkäufer dahinter, die etwas verkaufen wollen. Auch wenn sie am Telefon seriös und freundlich klingen. Sie wollen an persönliche Daten kommen, um dann Steuersparmodelle in Form von Immobilien anzubieten, sagt Verbraucherschützer Johann Tillich.
Reagieren Sie am besten gar nicht auf Immobilienangebote, wenn Sie nicht selbst Interesse haben.
Berechnung Den Zugang zu potenziellen Käufern finden die Verkaufsprofis meist über ein "Steuersparmodell", das anhand eines Immobilienkaufs erklärt wird. "Ich habe mich über das Steuersparmodell über denkmalgeschützte Immobilien informiert und das gab und gibt es wirklich. Also wir haben uns auf der sicheren Seite gefühlt. Und mussten dann feststellen, dass wir abgezockt wurden ...", sagt Michael Maier. Aber: Kein seriöser Immobilienverkäufer oder Bankberater würde die Steuerersparnis beim Immobilienkauf in die Rechnung mit einbeziehen.
Kredit und Notartermin
Darlehen Eine Wohnung ohne Eigenkapital zu kaufen, ist bei unseriösen Angeboten angeblich kein Problem. In einigen uns vorliegenden Fällen wurden sogar von den Immobilienvermittlern bestehenden Darlehen kurzfristig abgelöst, bzw. es wurde nicht vorhandenes Eigenkapital vorgetäuscht. Diese Beträge waren bereits im Kaufpreis enthalten und wurden wieder an den Immobilienvermittler zurückgezahlt. In diesen Fällen handelt es sich bereits um Betrug. Sollten vom Mobile Vermittler sollen wurde gekommen, ist das ein Hinweis, dass sie vorliegt. In diesen Fällen Finger weg von einem Kauf.
Aber: Keine Hausbank würde das in der Regel zulassen, ohne den Kreditnehmer genau zu kennen.
Wenn der Kredit kurzerhand organisiert wird, ohne dass man selbst mit der Bank gesprochen hat, sollte das ein Warnzeichen sein, sagt Verbraucherschützer Johann Tillich.
Überstürzte Notartermine sind immer unseriös. Und wenn Ihnen ein Notarvertrag nicht 14 Tage vor der Beurkundung zugeschickt wird, sollte man stutzig werden. Eine goldene, ungeschriebene Regel unter seriösen Immobilienvermittler lautet: Der Kaufinteressent kann den Notar bestimmen. Das sollte grundsätzlich gelten, fordert Johann Tillich.
Hilfe bei Betrug
Wenn Sie bereits in die Falle getappt sind oder das Gefühl haben, eine überteuerte Immobilie gekauft zu haben, sollten sich an den Verein für Existenzsicherung (VfE), der mit seinen Rechtsanwälten die Fälle prüft und eine außergerichtliche Einigung mit den finanzierenden Banken anstrebt und auch strafrechtliche Schritte gegen die Vermittler einleiten wird. Aus diesem Grund ist es besonders wichtig, dass die Betroffenen bei einer Stelle zusammenschließen. Jeder Wohnungserwerber sollte bei der Hausverwaltung eine Liste Miteigentümer anfordern. Der Verein für Existenzsicherung e.V. wird dann versuchen, diese Miteigentümer zu bündeln. Sollte sich die Hausverwaltung weigern, Ihnen diese Liste zu geben, helfen unsere Anwälte weiter.
Problematisch: Von Betrug kann nur dann gesprochen werden, wenn "unwahre und irreführende Zusicherungen" seitens der Vertreter gemacht wurden. Doch der Nachweis ist in vielen Fällen schwierig, sagt Rechtsanwalt Tobias Neumeier. Schon aus diesem Grund ist es wichtig, dass sich die Eigentümer zusammenschließen um die Beweise zu ermitteln.
Dennoch sollten alle Betroffenen Anzeige wegen Betrugs erstatten, empfiehlt Rechtsanwalt Tobias Neumeier.