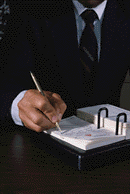Insolvenzverwalter müssen die Steuererklärung machen!

Oft versuchen die # Insolvenzverwalter den Schuldner zu zwingen, die Steuererklärung auf seine Kosten zu machen! Dies ist jedoch nicht richtig.
Wie ist die Rechtslage?
In der #Insolvenz muss eine Steuererklärung abgegeben werden. Vor allem, wenn mit einer Steuererstattung zu rechnen ist. Allerdings gibt es Regeln, wer in welchem Stadium der Insolvenz die #Steuererklärung abgeben darf.
Abgabe der Steuererklärung im laufenden Insolvenzverfahren.
Befindest du dich in einem laufenden #Insolvenzverfahren, darfst du deine Steuererklärung nicht mehr selbst abgeben. Nach § 80 InsO i.V.m. § 34 Abs. 3 AO ist dein Insolvenzverwalter für die Abgabe deiner Steuererklärungen zuständig.
Du musst lediglich alle dafür 📑 notwendigen Angaben machen, die für die Erstellung deiner Steuererklärungen erforderlich sind. Dies ergibt sich aus deinen Mitwirkungspflichten nach §§ 20 und 97 InsO.
Abgabe der Steuererklärung während der Wohlverhaltensphase.
Wenn das eigentliche Insolvenzverfahren aufgehoben wurde und du dich in der sogenannten 😇 Wohlverhaltensphase befindest, kannst du deine Steuererklärung wieder selbst abgeben.
Verwendung von Steuererstattungen
Während des laufenden Insolvenzverfahrens fließen alle Steuererstattungen in die Insolvenzmasse, um die offenen Schulden zu tilgen. In dieser Zeit hast du also keinen Rechtsanspruch auf deine Steuererstattungen, da diese in voller Höhe zur 📉 Schuldentilgung verwendet werden.
Befindest du dich dagegen in der Wohlverhaltensphase, also der Phase der Restschuldbefreiung, erhältst du die Rückerstattung wieder in voller Höhe und musst auch keinen Teil davon an die Insolvenzmasse abführen.
Ehegatten im Insolvenzverfahren.
Bist du verheiratet und erfolgt eine 🧑🤝🧑 Zusammenveranlagung, so ist die Steuererklärung nicht nur von deinem Insolvenzverwalter zu unterschreiben, sondern auch von deinem Ehepartner, der sich nicht im Insolvenzverfahren befindet.
Wichtig ist hier noch, dass beim Finanzamt eine ➗ Aufteilung der Steuererstattung nach § 268 AO beantragt werden muss, da sonst auch der Anteil deines Ehepartners, der sich nicht im Insolvenzverfahren befindet, in deine Insolvenzmasse fällt. Dieser Antrag muss dann durch deinen Ehepartner gestellt werden.
Wichtig!
Immer wieder hören wir von unseren Mandanten, dass Insolvenzverwalter mit allen möglichen Ausreden und Tricks versuchen, den Mandanten dazu zu bringen, die Steuererklärung selbst zu machen. Lassen Sie sich hierbei von Ihrem #Schuldnerberater oder #Insolvenzberater unterstützen. Eine gute #Schuldnerberatung ist für die Mandanten wichtig, um sich auch gegen Insolvenzverwalter durchzusetzen oder Hilfe zu erhalten. Hier unterstützen wir unsere Mandanten bis zur Restschuldbefreiung.